In Office 365 hat ein Anwender viele Möglichkeiten, seine Aufgaben zu organisieren. Mit Planner, To Do, Project und Tasks in Teams bietet Microsoft verschiedene Tools an, um die Arbeit und Projekte zu organisieren. Viele Nutzer haben jedoch Probleme mit den verschiedenen Tools bzw. schöpfen das Potential nicht voll aus. Welches Tool soll der User wann nutzen bzw. welches ist nun das richtige? Auf der Ignite 2023 hat Microsoft die neue Planner-App angekündigt. Diese soll den Planner, To Do sowie "Project im Web" in einer App in Teams und später im Web vereinen. Wenn Sie dann noch Teams Premium lizensiert haben, können Sie sogar KI einsetzen.

"Tasks in Planner und To Do" in Teams synchronisiert die Aufgaben, die Sie in To Do erstellt haben. Arbeiten Sie jedoch mit der Project App, werden diese Daten nicht mit angezeigt bzw. mit Teams synchronisiert. Der neue Planner soll dies ändern. Anwender sollen in Teams direkt Ihre Projekte planen, überwachen und Aufgaben verteilen können, ohne diese App zu verlassen. Damit wären dann Ihre täglichen Aufgaben, zugeteilte Aufgaben und Ihre Projekte an einem Ort in einer App.

User, die bereits mit Project arbeiten, werden sich schnell zurecht finden im neuen Planner, da hier alle Funktionen aus Project im Web verfügbar sein sollen. Projekte, die Sie in "Project im Web" angelegt haben, werden im Laufe des Jahres 2024 mit der neuen Planner App in Teams synchronisiert, sodass Sie auch auf "bereits begonnenen Projekte" in Teams zugreifen können. Mit den Vorlagen können Sie einfache und komplexe Projekte planen. In unterschiedlichen Ansichten erhalten Sie einen Überblick über das Projekt, erledigte und noch bestehenden Aufgaben etc. Mit Team Premium können Sie darüber hinaus mit Hilfe von Copilot Projekte planen.

Die Timeline im Planner zeigt Ihnen an, wo Sie gerade im Zeitplan des Projektes sind und der Endzeitpunkt wird automatisch angepasst. Aufgaben können per Drag & Drop einfach verschoben und verteilt werden. Auch Kollisionen einzelner Aufgaben werden angezeigt. So können Sie rechtzeitig reagieren und evtl. Aufgaben umverteilen bzw. anpassen. Folgeaufgaben, die in einem Teams Meeting festgelegt und evtl. schon angelegt wurden, werden mit dem neuen Planner synchronisiert.

Mit Planner können Sie auch in Loop arbeiten. In diesen Arbeitsbereichen können Sie mit Kollegen alles zu einem Thema zusammenfügen und bearbeiten wie bspw. Projekte. In Loop soll es den Anwendern auch ermöglicht werden, direkt auf die Daten im Planner zuzugreifen. Darüber hinaus, wird der neue Planner in Viva Goals integriert.
In Meet the new Microsoft Planner erhalten Sie eine kurze Übersicht darüber, was der neue Planner alles kann.
Wenn Sie es gerne ausführlicher sehen möchten, sollten Sie sich die Präsentation von Seth Patton (General Manager für Produktmarketing bei Microsoft) von der Ignite 2023 The new Microsoft Planner: Bring together to-dos plans and projects | OD21 ansehen. Hier stellen er und seine Kollegin Anav Silverman (Group Product Manager, Tasks and Work Management) den neuen Planner vor.
So sehen die Pläne aus:
Die jetzige "Tasks in Planner und To Do" App in Teams wird in Planner umbenannt. Mit der Umbenennung in Teams sollen im Frühjahr 2024 die Funktionen von "Project for the Web" hinzukommen. Später im Jahr 2024 soll der neue Planner im Web verfügbar sein.
Microsoft 365 Kunden können die Premium Funktionen im neuen Planner in Teams für 30 Tage kostenlos nutzen. Dazu zählen "Project im Web" und Copilot. Kunden die bereits "Projekt im Web" lizensiert haben, können die neue Planner App in Teams mit den Premium Funktionen ohne Zusatzkosten nutzen, solange die Lizenz besteht. Alle nicht Premium Funktionen können mit jeder Microsoft 365 Lizenz genutzt werden. Microsoft plant die "Projekt im Web-App" in Planner umzubenennen. Alle Funktionen der Projekt-App werden im neuen Planner verfügbar sein, des weiteren sollen noch neue Features hinzukommen. Genau Preise hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben, diese werden wahrscheinlich mit dem Launch verkündet.
Sie möchten eine(r) der ersten sein, die Information zum neuen Planner bekommen? Dann tragen Sie sich doch in die Mailing Liste von Microsoft ein. Sie haben noch Fragen? Microsoft hat eine FAQ in der Techcommunity veröffentlicht.
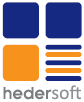


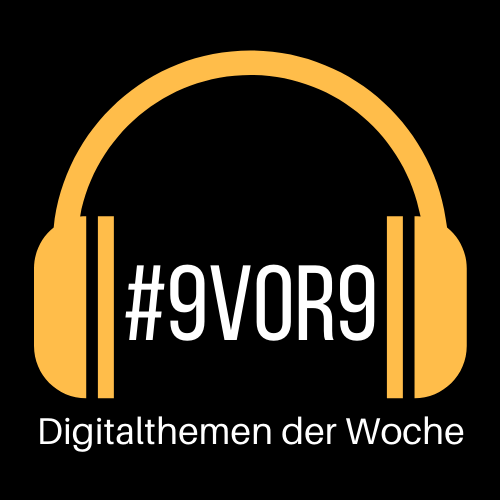






 A life without animals is not worth living
A life without animals is not worth living