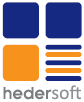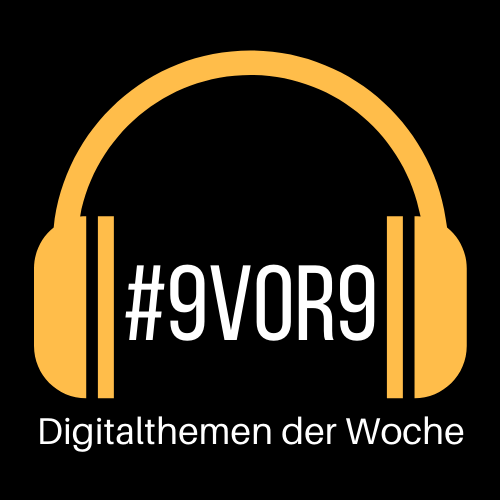Deutschland und die Digitalisierung. Zwei Welten prallen aufeinander? Ganz korrekt sind diese Sätze nicht, denn natürlich kann man nicht alles über ein Kamm scheren und zudem geht es mir in diesem Blog um die öffentliche Verwaltung, um Gesundheits- und Schul- bzw. Bildungswesen. Und dort treten nicht erst, aber gerade in Zeiten der Pandemie erhebliche Missstände an den Tag. Einige Beispiele:
Christian Reinitz kommentiert anlässlich eines Jahres Pandemie in der FAZ vom 20. Februar 2021* und prangert die Schwachstellen im medizinischen System an: den Föderalismus und die Digitalisierung. An zu vielen Stellen halt es, ob es um die Meldung der Inzidenzzahlen oder der Impfquoten an das RKI über E-Mail und Fax, über eine teilweise mittelalterliche Vergabe von Impfterminen, um digitale Gesundheits- und Patientenakte, digitale Test- oder Impfpässe oder sichere Vernetzung zwischen Kliniken und Ärzten und datenschutzkonforme Übermittlung, Speicherung und Austausch von Patientendaten geht. Natürlich, es gibt hier und da Ausnahmen und Leuchtturmprojekte, aber in der Regel knirscht es im System, um es noch vorsichtig auszudrücken. Und mir scheint, Föderalismus, zu verteilte Kompetenzen und natürlich auch bürokratische Prozesse, Schwerfälligkeit und wohl auch Verteidigung der eigenen Besitzstände sind verantwortlich für das Trauerbild.
Ähnlich sieht es in Bildung und an Schulen aus. Ich habe ja die Tage mit Lars Basche in #9vor9 darüber berichtet und hier entsprechende Artikel gesammelt. Auch dort wieder vereinzelte Leuchtturmprojekte, aber generell scheint auch dort der Föderalismus, die Bürokratie und besagtes Verharrungsvermögen die Ursache dafür zu sein, dass wir nicht in der Geschwindigkeit digitalisieren, wie es gerade in Zeiten der Pandemie notwendig wäre. Erschwerend kommen natürlich in Zeiten, in denen es auf Geschwindigkeit ankommt, das öffentliche Vergaberecht mit seinem oft Ausschreibungsprozess und seinen Fristen hinzu. Man kann doch eigentlich nur wütend werden, wenn man dann liest, dass aus dem Digitalpunkt Schule vom Frühjahr 2019 von zur Verfügung gestellten 5 Milliarden Euro erst 112 Millionen abgeflossen und 743 Millionen Euro bewilligt wurden. Das kann es doch einfach nicht sein, sagt sich der gesunde Menschenverstand.
Oben drauf kommt dann noch, dass Deutschland beziehungsweise die Länder nicht in der Lage scheinen, eine vernünftige deutsche oder europäische Schul-Cloud aufzubauen und stattdessen einmal mehr die Angebote amerikanischer Monopolisten nutzen und diese noch stärker machen. Auch hier scheint mir der Föderalismus, besser die Kleinstaaterei und das Machtgehabe der Länder einer der entscheidenden Hemmnisse zu sein. Auch in diesem Thema scheint klarer zentraler Kompetenz und Steuerung notwendig – mit scharfem Auge auf Projektfortschritte und Finanzierung.
Digitalprojekte scheitern schon seit Jahren
Dies sind zwei angesichts der Pandemie hervorstechende Bereiche, die nach Digitalisierung und weniger Föderalismus schreien. Die Liste lässt sich problemlos verlängern, z.B. in Richtung Vergabe der Hilfsmittel, was – so scheint es – auch durch Digitalisierung und weniger Bürokratie, Formular- und Vorschriftswesen deutlich beschleunigt werden könnte. Jenseits der Pandemie gibt es noch viele weitere Beispiele dafür, wie wenig effektiv Digitalisierung in der deutschen öffentlichen Verwaltung vorangetrieben wird.
Entgegen aller vollmundigen Verlautbarungen über digitale Souveränität scheint parallel dazu die Abhängigkeit besonders vom Giganten Microsoft zu steigen. Weil man es selbst nicht gebacken bekommt oder nicht gebacken bekommen will gab die Bundesregierung 2020 178,5 Millionen Euro für Software-, Cloud- und Serverdienste aus Redmond aus. 2015 waren es noch 43,5 Millionen. Auch Beratungsunternehmen, die der deutschen öffentlichen Verwaltung aufs Pferd heben sollen, freuen sich über entsprechende Honorare – und das schon zu Uschis Zeiten auf der Hardthöhe.
Und schauen wir zurück: 2015 gab es einen Beschluss des Bundeskabinett 2015, Bundesministerien und -behörden bis 2025 mit moderner IT auszustatten. Der Wildwuchs an Rechenzentren sollte beseitigt und die unterschiedlichen IT-Arbeitsplätze vereinheitlicht werden. Welche eine Chance auch, eine deutsche Bundesverwaltungs-Cloud aufzubauen und die eigene deutsche Softwareindustrie zu stärken. Es hätte ein Marshall-Plan für die digitale Souveränität werden können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Zielvorgaben und Kosten wurden verfehlt, der Bundesrechnungshof mahnte an, das Projekt wurde neu organisiert – und jetzt schauen wir mal. Unterdessen kassiert vor allem Microsoft weiter, und wahrscheinlich weiter und weiter und weiter …
Muss IT in und für die öffentliche Verwaltung ganz anders aufgesetzt werden? Von Softwarentwicklung bis Implementierung
Kann deutsche öffentliche Verwaltung einfach keine Digitalisierung und IT? Müssen hier andere Prozesse und Institutionen vom Digitalministerium bis hin zu unabhängigen, von deutschen Firmen betriebenen und durch öffentlich Aufträge finanzierte Software-Konsortien implementiert werden? Muss es eine deutsche oder europäische Mozilla-Foundation geben, mit dem Ziel Lösungen für die öffentlicher Verwaltung und darüber hinaus nach dem Open Source-Konzept zu bauen? Die traditonelle Verwaltung, die Ministerien scheinen das Thema jedenfalls bisher nicht in den Griff bekommen zu haben. Ja, es gibt einige mehr als zarte Pflänzchen und wir werden uns bald mit Peter Ganten, dem Vorsitzenden der Open Source, darüber unterhalten. aber generell scheint es sehr düster auszusehen.
Die Liste gescheiterter oder schwächelnder Projekte könnte sicher fortgesetzt werden, doch ich möchte einen anderen Aspekt der Digitalisierung und der öffentlichen Verwaltung beleuchten. Und vorab möchte ich es mit Herta aus den Känguru-Chroniken sagen: „Es jibt sone und solche, und dann jibt es noch janz andre, aba dit sind die Schlimmstn.“ Nochmals klar und deutlich: Viele Mitarbeiter:innen der öffentlichen Verwaltung sind bürgerfreundlich und bemühen sich, aber …
Digitalisierung banal: Anfrage einfach mal per E-Mail beantworten
Vor geraumer Zeit habe ich Unterlagen per E-Mail an das Gesundheitsamt Darmstadt, die diese angefordert hatten. Die E-Mail war auf dem Schreiben, das ich vom Amt bekommen hatte, angegeben und als halbwegs digitaler Mensch habe ich die Unterlagen gescannt und geschickt. Danach kamen per Briefpost Mahnungen. Also habe ich den Hörer in die Hand genommen und dort angerufen. Eine nette Frau am Telefon, ich frage nach der Kollegin. Ja, die ist nicht da. E-Mail? Wie lange her? Kann sein, dass wir die schon gelöscht haben. Das tun wir in regelmäßigen Abständen. Ich schlucke, bleibe aber freundlich und schicke die Unterlagen nochmals per Fax (!!) und E-Mail an die Stadt. Am kommenden Tag rufe ich an. Ja, die Unterlagen seien angekommen. Wochen später bekomme ich dann die Unterlagen vom Amt natürlich per Post.
Ein anderer Fall: Wir mussten eine Beglaubigung wegen Änderungen im Grundbuch machen. Termin auf dem Ortsgericht ausgemacht, mit meiner Frau hin und die Dokumente beglaubigen lassen. Es war ein Schauspiel: Der nette Beamte beglaubigte die zwei Dokumente in einer Stempelorgie und nahm handschriftlich entsprechende Eintragungen in einem Buch vor. Hier alles ok. War eine Reminiszenz an Verwaltung, wie ich sie seit Jahrzehnten kenne.
So weit, so gut. Und dann schrieb ich in meiner Naivität per E-Mail – die Adresse steht auf der Homepage der Digitalstadt Darmstadt – an das Grundbuchamt, ob ich die beglaubigten Dokumente elektronisch zuschicken könne. Ok, war dumm und naiv. Hätte ich mir als logisch denkender verwalteter Bürger denken können. Nach einigen Tagen kam dann per Briefpost die Antwort, nein, das ginge nicht. Per Briefpost! Die Mitarbeiter:innen waren es nicht gewohnt, einfach die E-Mail zu beantworten.
Und noch eine Erfahrung meiner Mutter, diesmal nicht in Darmstadt. Meine Eltern müssen die Tage neue Ausweise von der Stadt (Leun) abholen. Also rief meine Mutter dort an, ob sie nicht einfach die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl mitnehmen könnten. Nein das ginge nicht. Das müsse den vorgeschriebenen Weg gehen, per E-Mail – immerhin – oder per Post**. Trotzdem …
Es braucht auch Veränderung in den Köpfen der Beamten:innen
Nun bin ich von den großen Themen der Digitalisierung hinunter gestiegen in den täglichen menschlichen Bürger- und Verwaltungsalltag. Warum habe ich diesen „Abstieg“ vorgenommen? Jenseits der notwendigen IT-Ausstattung und besseren Projektmanagements brauchen wir auch eine Änderung des Verhaltens vor Ort bei den einzelnen Beamten:innen, den Mitarbeiter:innen der öffentlichen Verwaltung und ihren Führungskräften. Wie kann es sein, dass man den Posteingang einfach löscht? Warum wird nicht unbürokratisch und schnell per E-Mail auf eine Frage geantwortet? Warum ist der Servicegedanke, Ich, Mitarbeiter:in der öffentlichen Verwaltung bin für meine Bürger:innen da und versuche ihn so gut es geht schnell und unbürokratisch zu helfen so selten ausgeprägt?
Ich denke, auch hier muss angesetzt werden. Es braucht ein anderes Bewusstsein, den Servicebeauftragten in der Verwaltung, der diese Missstände abstellt, die Beamten:innen schult und coacht, anders, moderner, digitaler, bürgerfreundlicher zu arbeiten. Es tut auch gar nicht weh – und kostet auch nicht den eigenen Job. Und an diesen Servicebeauftragten können auch Bürger:innen ihre Ideen, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden richten.
Ich lebe in der Digitalstadt Darmstadt und die Verantwortlichen scheinen darauf sehr stolz zu sein. Hier wurden und werden auch einige interessante Projekte durchgeführt. Gerade werden Ideen für eine urbane Datenplattform gesammelt, um städtische Entscheidungs- und Planungsprozesse zu unterstützen und zu beschleunigen. Wir laden nochmals Verantwortliche der Digitalstadt Darmstadt GmbH herzlich in #9vor9 ein, um die Initiative vorzustellen.
Jedoch sollte ein Stadt, die diesen Anspruch hat, gerade am persönlichen Bürgererlebnis ansetzen und genau wie oben vorgeschlagen mit diesen oder anderen Angebot die öffentliche Verwaltung einfach bürgernäher gestalten – und das nicht nur in Corona-Zeiten. Falls ich hier bestehende Angebote übersehen habe, bin ich für Aufklärung natürlich sehr dankbar und entschuldige mich natürlich auch, wenn ich wo falsch gelegen habe. Ach ja, es ist ja auch bald Kommunalwahl und ich sehe auf manchem Plakat durchaus das Stichwort Digitalisierung …
Kann die deutsche Politik (und Verwaltung) nur Schönwetterreden, aber keine Digitalisierung
Wenn man sich all das anschaut und selbst als Bürger:in „erleidet“ – und die Liste kann leicht verlängert werden – und auf der anderen Seite ach so viele Schönwetterreden vieler Politiker hört, kommen immer größere Zweifel auf, ob wir es in Deutschland „noch können“. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass viel geredet und wenig gehandelt wird. Ist ja auch bequemer über Visionen schön zu fabulieren, als Projekte schnell, konsequent und zielorientiert durchzuziehen, einfach anzupacken.
(Stefan Pfeiffer)
* Nur eine Randbemerkung, nichts zur Sache Digitalisierung und öffentliche Verwaltung: Ich finde es immer sehr schade, wenn Artikel in der gedruckten Ausgabe der FAZ erschienen sind und erst später digital veröffentlicht werden.
** Sicher ist das keine Digitalisierungsfrage, aber es zeigt einmal mehr die Servicehaltung, die manchmal in der öffentlichen Verwaltung zu herrschen scheint.